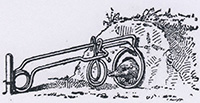| Berufe, die es einmal
gab und zum Teil auch heute noch gibt |
von Franz
Josef Blümling |
|
|
| |
| |
| Weitere Berufe
werden im Laufe der Zeit noch
beschrieben |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
|
| |
|
 Die besondere Geschichte
des Neefer “Backes” Die besondere Geschichte
des Neefer “Backes”Das
“tägliche Brot” ist seit
Jahrtausenden eines der wichtigsten
Grundnahrungsmittel der Menschen. Und
weil es diese existenzielle Bedeutung
hat, ist die Bitte “Unser täglich
Brot gib uns heute” in das
Vaterunser eingegangen.
Die Backmethode hat sich grundlegend
geändert.. Mit Fertigbackmischungen
werden heute auf die Schnelle die
verschiedensten Großproduktionen
hergestellt. Doch wie sah es früher aus?
Wie backte man früher das Brot?
Das Backen von Brot war eine
öffentliche Angelegenheit. Im Dorf stand
ein Backofen, der von der
Dorfgemeinschaft nach festgelegten Regeln
gemeinsam genutzt wurde. Das Haus, in dem
der Backofen stand, wurde landläufig
“Backes” genannt.
Bereits im Jahr 1540 überließ das
Koblenzer Stift St. Florin, das in Neef
begütert war, der Gemeinde einen Platz
zum Bau eines Backofens. Dafür standen
dem Stift jährlich 3 Sester Wein (1
Sester = 5,25 Liter) zu. Hierbei fällt
die niedrige Zinsleistung auf. Und das
hatte seinen Grund. Als Leibeigene des
Grundherren mussten die Bauern im
Besonderen die Weinberge bestellen. Sie
hatten das Land gepachtet, und als
Pachtzins war im St. Floriner Klosterhof
die Hälfte der Ernte abzugeben. Zur
Verrichtung für diese harte Arbeit war
das tägliche Brot unverzichtbar. Es ist
also damit auch erklärt, warum in keinem
Güterverzeichnis eines Grundherren von
Neef ein Backhaus aufgeführt ist, wo
doch ansonsten jeglicher Besitz, selbst
wenn er von geringer Bedeutung erscheint,
akribisch bis hin zum kleinsten Detail
erfasst ist.
Als erster Bäcker hat ein Jude im
“Backes” das Handwerk eines
Bäckers ausgeübt - zu erkennen daran,
dass an der Außenwand des neu erstellten
Backhauses in der Nähe der Eingangstür
ein Wasserbecken angebracht war. Bevor
man das Haus betrat wusch man sich als
Symbol der Reinigung und der Ehrlichkeit
des Besuches die Hände.
Das vermutlich im 15./16. Jahrhundert
entstandene Gewohnheitsrecht dürfte auch
für das Neefer Backhaus zutreffend
gewesen sein. Die Regelungen besagen,
dass dem Bäcker im Backhaus mitzuteilen
ist, wann der einzelne Bürger sein Brot
backen will. War der Zeitpunkt
eingeplant, musste der Bäcker den Teig
im Hause des Backenden abholen, und wenn
das Brot gebacken war, hatte er es wieder
hinzubringen. Für diese Dienstleistung
erhielt er einen festgesetzten Lohn -
musste dafür allerdings auch noch das
Feuerholz holen und in den
“Backes” tragen. Ausdrücklich
festgelegt ist, dass dem, der das Brot
backen ließ, das Recht zustand, das auf
dem Tisch zurückgebliebene kostbare
Mehl, in dem der Brotteig vor dem Backen
geknetet wurde, “mit der Hand
abzustreichen und ohne Hinderung des
Bäckers mitzunehmen”. Zudem war der
Bäcker verpflichtet, zusätzlich Brot in
einer festgelegten Menge zur Versorgung
von Fremden und Durchreisenden
bereitzuhalten. Einen kleinen Teil der
gebackenen Brote zweigte er für diesen
Zweck ab. Wenn sich der Bäcker nicht an
die Regelung hielt, musste er ein
Bußgeld an die Gemeinde zahlen.
Von 1743 bis 1750 verwaltete nun vom
Backhaus aus Carl Michael Emmerich von
Metzenhausen als kurtrierischer
Oberforstmeister und Oberjäger die
Neefer Forst - im so genannten
“Kameralhof” (Carmeralia /
Kammerbeamter). Danach wurde Sebastian
Rebling Revierförster in diesem Dienste
des Kurfürsten. Der “Backes”
wurde nunmehr von einem beauftragten
Knecht, der in der Leibeigenschaft des
Herren stand, in gewohnter Art und Weise
betrieben. Es dürfte sich dabei um Anton
Dorbach, der am 4. Februar 1778 die Anna
Maria Peden geheiratet hatte, gehandelt
haben. Als Knecht und Magd sind beide
ausdrücklich im Neefer Familienbuch
aufgeführt.
Der Kurstaat wurde aufgelöst. Der
Neefer Wald kam an das Land Preußen. In
einem neu erstellten Forsthaus wurde
Peter Kaufmann als preußischer Förster
eingesetzt. Das Backhaus kam nunmehr in
die Hände eines freien und
selbständigen Bäckers, was der
vormalige Knecht Anton Dorbach gewesen
sein könnte. Die Leibeigenschaft war ja
zwischenzeitlich durch Napoleon
abgeschafft worden.
Die alte Neefer Bäckertradition wurde
in späterer Zeit durch den
Bäckermeister Rudolf Blümling (1885
– 1966) fortgesetzt. Sein Sohn
Werner (1911 – 2002) übernahm
Bäckerei und führte sie bis ins hohe
Alter fort. Es gab keinen Nachfolger.
Literaturnachweise: Das Stift
St. Florin zu Koblenz, Studien zu
Germania Sacra 6, Veröffent-
lichungen des Max-Planck-Institutes für
Geschichte, 42/U.1416
Rathaus war zugleich Backstube, Hermann
Schäfer, aus: Die Rheinpfalz
Nr. 27m cin 02.02.2010
Forst und Jagd im alten Erzstift Trier,
Fritz Michel, S. 173
www.naves-historia.de Inhalt - lfd. Nr.
26
Familienbuch Neef, 1700 – 1798, Jens
Kallfelz u. Otto Münster, Nr. 63
Bildnachweise: F. J. Blümling
|
 |
| Das Backhaus, in
dem auch zwischenzeitlich ein
kurtrierischer Beamter die Neefer
Forst verwaltet |
| |
 |
| Der Backofen ist
in seinem ursprünglichen Zustand
bis heute noch erhalten
geblieben. |
|
| |
|
 Brunnenbauer /
Brunnenputzer Brunnenbauer /
BrunnenputzerSie werden in den Annalen
von Neef nicht erwähnt. Es muss sie
jedoch gegeben haben - wie es sie auch in
jedem anderen Dorf gegeben hat. Das
Brunnenwasser war unabkömmlich - ja
sogar lebenswichtig. Von einer
Wasserversorgung wie sie heute üblich
ist, war man weit entfernt.
Der recht oft vorkommende Familienname
Brunnenbauer beweist, wie üblich dieses
Handwerk einmal war. Ab Mitte des 14.
Jahrhunderts wurden Familiennamen
eingeführt, und man nannte sich unter
anderem auch nach seinem Beruf.
Damit die Brunnen immer sauberes
Wasser hatten, musste der Brunnenputzer
regelmäßig die Sauberkeit des Brunnens
nachprüfen und ihn auch putzen. Es
konnte z. B. schon einmal vorkommen, dass
das Brunnenwasser durch Wanderratten vom
Pest-Virus infiziert war. So hatte sich
diese verheerende Seuche, die
“Geißel des Mittelalters“, von
Ort zu Ort weiter verbreitet.
Es gab aber auch Menschen, die aus
welchen Gründen auch immer, Brunnen
vergifteten. Wurden sie erwischt, drohte
ihnen die Todesstrafe.
Bis es die Wasserleitung im Dorf gab, ab
dem Jahr 1926, hatten etliche Familien
ihren eigenen Brunnen. Zur allgemeinen
Benutzung befanden sich aber auch einige
Brunnen an öffentlichen Stellen im Ort.
Der einzige heute noch erhaltene
öffentliche Brunnen steht vor dem alten
Feuerwehrhaus und hat ausschließlich
historische Bedeutung.
|
 |
Der Brunnen vor
dem alten Feuerwehrhaus
Foto: Iris Dahmen, Neef |
| |
| |
| |
| |
|
| |
|
 Fahrendes Volk Fahrendes Volkder
auch fahrende Leute genannt, hatten
keinen festen Wohnsitz.
"Fahren" ist nicht in der
heutigen Bedeutung zu verstehen. Bis weit
ins 19. Jahrhundert, als Wohnwagen als
Transportmittel und Unterkunft aufkamen,
waren "Fahrende" vor allem zu
Fuß mit vielleicht einem zweirädrigen
Karren als Hundegespann oder
selbstgezogen unterwegs. Sie zogen
alleine oder familienweise von Ort zu Ort
und übernachteten in einsamen Scheunen
oder lagerten außerhalb des Ortes unter
freiem Himmel. Dort richteten sie auch
ihren Arbeitsplatz ein. Im Mittelalter
und in der Frühen Neuzeit gehörten sie
zum „niederen Volks“ und waren
die sogenannten „unehrliche Leute“.
Als solche galten sie als anrüchig und
wurden verachtet. Gesetze und Kirche
stießen sie aus. Sie waren rechtlos und
die kirchlichen Sakramente blieben ihnen
vorenthalten.
Bettler
Die Bettelei war im Mittelalter nur
innerhalb des eigenen Wohnortes erlaubt.
In diesem Umfeld war es die Aufgabe
sozial höherer Schichten, gegen die
Armut mit Barmherzigkeit vorzugehen. Trat
ein fremder Bettler auf, so war er ein
Parasit in der dörflichen Gemeinschaft.
Man stellte ihn an den Pranger und
verwies ihn aus dem Ort.
Wiederholungstäter sperrte man bei
Wasser und Brot in das Gefängnis. Aus
der Hoffnungslosigkeit heraus fing man an
zu stehlen und war schließlich allzu
gerne bereit, bei organisierten
Raubzügen mitzuwirken.
Vaganten / Vagabunden / Vagi
Insbesondere junge Männer mit
handwerklichen Fähigkeiten, die zu Hause
keine Arbeit fanden, gingen als
sogenannte Vaganten auf die Wanderschaft
und suchten draußen nach Arbeit. Fand
man eine solche, dann war diese in aller
Regel nur vorübergehend. So kehrten die
Vaganten immer wieder nach Hause zurück.
Dort, ohne Arbeit, waren sie dem
Wohlwollen der Mitbürger ausgeliefert.
Die Zahl der Vaganten konnte in Zeiten
großer Not bis zu 20% der Bevölkerung
ausmachen. In Räuberbanden treffen wir
sie immer wieder an.
Dann gab es noch die nicht sesshaften
Vaganten, die zumeist eine Dienstleistung
anzubieten hatten und waren oft
Kesselflicker, Wunderheiler,
Scherenschleifer, Krämer, Scharfrichter
und Schinder. Sie wurden von vornherein
für Verbrecher gehalten und
dementsprechend verfolgt. Regelrechte
Treibjagden wurden auf sie abgehalten.
Benachbarte Grundherren ordneten in den
Dörfern in regelmäßigen Abständen
gemeinsame Streifen an, die mit
Fangprämien für diese „Landstreicher“,
die bis zu 5 Gulden betrugen, belohnt
wurden. In Koblenz ahndete man das
Vagabundieren sogar mit mehrjährigen
Galeerenstrafen.
Landknechte
Eine weitere Gruppe, die immer mehr ins
Abseits geriet, waren die Landsknechte.
Dauerte der Krieg an, hatten sie
"Arbeit". Im Einsatz reichte
der Sold, wenn er überhaupt gezahlt
wurde, meist für das Überleben nicht
aus. War "ein Loch im Krieg",
also kein offizielles Kriegsgeschehen im
Umfeld, waren sie arbeitslos. Oft hatten
die Landsknechte auch das Kriegsgeschehen
über, und desertierten aus der Armee.
Dann waren sie von vornherein völlig
mittellos. Die Not entwickelte sich zum
ständigen Begleiter und zwang sie zum
Umherziehen. Bei Bauern suchten sie
Arbeit. Letztlich mussten sie auch
betteln gehen. Das Untertauchen in einer
Bande war vorgezeichnet. Wegen ihrer
berufsmäßigen Brutalität konnten Sie
sich dort umgehend nützlich machen.
Lumpensammler
Sie kauften für einen geringen Preis
abgetragene und zerschlissene Kleider und
sonstige Stoffreste. Dies alles
verkauften sie an Fabriken zur
Herstellung von Papier weiter.
Lumpensammler waren meist Alte und
Gebrechliche - aus gutem Grund. Wer erst
damit begonnen hatte, durfte nicht
hoffen, damit alt zu werden. Das harmlose
Wort Lumpen macht keine Vorstellung, was
alles auf den Karren der armen Schlucker
landete. Die größte Menge davon waren
Stofffetzen, die so verdreck waren, dass
für sie kein weiterer Einsatz zumutbar
war. Es waren Lappen, die zuvor der
Krankenpflege dienten oder auch solche,
welche die Frauen regelmäßig im Monat
zur Reinlichkeit benötigten. All diese
Fetzen waren oft verschimmelt und voll
von Würmern, Maden und Insekteneiern. So
waren Milzbrand und darüber hinaus
Infektionskrankheiten wie Krätze,
Rotlauf, Typus und Cholera häufige
Todesursachen in diesem Beruf.
Knochenhändler
entsorgten vor allem bei der ländlichen
Bevölkerung Knochenreste aus den
Hausschlachtungen. Dieses Material
benötigten Fabriken zur Herstellung von
Seifen.
Korbmacher
stellten nicht nur Körbe und Mannen
(große Körbe mit zwei Hänkel) her,
sondern reparierte auch solche. Er lebte
oft ein bescheidenes Dasein. Aus eigener
Erinnerung ist noch bekannt, dass er mit
einem einfachen Wagen kam, den ein schon
älterer Maulesel zog, der in seinen
Pausen angebunden an einer Leine auf der
Wiese graste. O wehe! - wenn er sich
einmal von der Leine löste und sich in
den Gemüsegärten „verirrte“!
Dann war die Volksseele aufgebracht! Es
gab hitzige Beschimpfungen. Eine
Entschädigung konnte kaum erwartet
werden. Ein paar Schnitzmesser und ein
Vorrat an Weidenholz – mehr besaß
er nicht. Er konnte bestenfalls mit einer
kostenlosen Reparatur oder, wenn der
Flurschaden hoch war, mit einem neuen
Korb den Schaden begleichen.
Hottengießer
kamen stets vor der Weinlese an die Mosel
und machten mit heißem Pech Hotten
wieder dicht. Früher waren die Hotten,
mit denen die gelesenen Weintrauben in
die Bütte getragen wurden, aus
Weidenholz geflochten. Regelmäßig
wurden diese Behälter undicht. So wurde
der Hottengießer vor der Ernte erwartet
und durfte nicht ausbleiben.
Wahrsager
Auch sie gehörten zu dem „Fahrenden
Volk“. Es waren zumeist Frauen. Sie
gingen von Haus zu Haus und boten schon
fast aufdringlich in Bettlermanier an,
die Zukunft vorher zu sagen. Oft waren es
Zigeunerinnen. Sie lasen von der Hand ab,
legten Karten, oder stellten am
Kaffeesatz fest, wie die Zukunft aussah.
Die Vorhersage war dann natürlich rosig.
Das beeinflusste nämlich die
Bereitschaft und auch die Höhe des
Entgeltes für die erbrachte „Dienstleistung“.
Besonders vorsichtig musste man sein,
wenn sie eine Begleitung mitbrachte.
Während die Wahrsagerin vertieft ihr
Gespräch hielt, sah sich ihr/e
Komplice/in in der Wohnung um und ließ
später etwas fehlen.
Tippelbrüder
Ursprünglich waren es die
Handwerks-Gesellen, die nach dem
Abschluss ihrer Lehrzeit durch die Lande
tippelten, um bei einem Meister ihres
Faches Erfahrungen zu sammeln. Dies
musste bewiesen werden, wenn man die
Meisterprüfung anstrebte. In neuerer
Zeit gibt es diese ehrbare Sitte kaum
noch - ab und zu sieht man noch
Zimmerleute, die sich auf der „Walz“
befinden.
So werden völlig zu Unrecht heute
heimatlose Umherstreuende Nichtstätige
als Tippelbrüder überbewertet.
Eigentlich fallen diese eher unter die
Einordnung der Bettler. Speziell nach dem
letzten Krieg gab es diese recht häufig.
Die einzelnen Gemeinden waren sogar
verpflichtet, ihnen eine Unterkunft
bereit zu stellen. Oft stand dazu sogar
ein ausgedeutetes gemeindeeigenes
Gebäude zur Verfügung.
Krämer / Hausierer
Hausierer gibt es heute so gut wie nicht
mehr. Sie gingen von Haus zu Haus, von
Klinke zu Klinke (daher waren es die
„Klinkenputzer) und boten in einem
Bauchladen ihr eigenes Sortiment an Waren
an. Es waren dies bevorzugt Kurzwaren.
Hausierer waren auf dem Lande ein fester
Bestandteil. Man richtete sich auf ihr
durchaus erwünschtes, oft ersehntes
Kommen ein. Eine Nebenfunktion ihrer
Tätigkeit war es, dass sie Nachrichten
und Informationen aus dem weiten Umfeld
überbrachten.
Literaturquellen:
Herre Paul, deutsche Kultur des
Mittelalters im Bilde, S. 84, 85
Meyers Großes Konversations-Lexikon,
1905
Miehe B., Gershausen, Heimatkalender des
Kreises Hersfeld-Rotenburg (1986, S. 69)
Bildernachweis:
Bettler alter Stich, Herkunft unbekannt
Landknecht Stich von Hans Guldenmund, in
Kaiser, in: Kaiser, Gott und Bauer, Die
Zeit des
Deutschen Bauernkrieges im Spiegel der
Literatur
Korbmacher Foto aus dem Archiv von Kurt
Bergen, Neef
Krämer Holzschnitt 1568, aus: Eike Pies,
Zünftige und andere Berufe
|
 |
| Bettler |
| |
 |
| Landsknecht |
| |
 |
| Krämer |
| |
| |
| |
| |
|
| |
|
 „Mies“ – der Feldschütz von
Neef
„Mies“ – der Feldschütz von
NeefDörflichen Gemeinden war es von
je her ein wichtiges Anliegen, ihre
Gemarkung vor allem zu schützen, was
eine ordnungsgemäße, friedliche
Flurnutzung störte. Um dies zu
gewährleisten, wurde ein Feldschütz,
auch Flurdiener oder Feldhüter genannt,
eingesetzt. Eine hochoffizielle
Tätigkeit des Feldschützen war es, vor
allem in den Moselgemeinden, in der
Lesezeit auf Geheiß des Bürgermeisters
„Wische“ aufzustellen. Mit
solchen Strohbündel zeigte er an, dass
dort keiner begehen durfte – auch
nicht der Eigentümer. Dies war eine
Handhabung, die aus einem
Gewohnheitsrecht beruhte und aus dem 17.
Jahrhundert stammte. So wurden besonders
Pfade und Wege gesperrt. Sinn dieses
Vorganges war, dass die reifenden Trauben
vor Diebstahl geschützt wurden. Nur der
Bürgermeister konnte Ausnahmen
genehmigen. Und diese machte er in
schriftlicher Form. Ansonsten war der
Feldschütz täglich unterwegs und
schaute nach, ob in den Obstgärten nicht
gestohlen wurde. So hatte er ganz
besonders die Kinder nicht auf seiner
Seite, die ja doch allzu oft auch über
Zäune stiegen und unberechtigt Kirschen,
Äpfel, Pflaumen und sonstiges Obst
klauten. Für die Bauersleute war er der
"Freund und Helfer", für die
Dorfjugend ein
„Schreckgespenst“.
Als sich die allgemeinen Verhältnisse
nach dem Krieg normalisiert hatten, wurde
auch wieder ein Feldhüter eingesetzt. In
Neef war es der Bartholomäus Braun
– genannt „Mies“ – s.
auch Stückelche 132. „Mies“
nahm sein Amt sehr ernst. Wenn er
unterwegs war, hatte er immer einen
kräftigen Eichenstock dabei und trug
eine hohe Schirmmütze. Wo immer er
auftrat, wann immer er unerwartet
gesichtet wurde, war der Respekt
allenthalben groß.
Wer war nun dieser „Mies“?
Zweifelsohne war er ein Original in der
Dorfgemeinschaft. In den ersten Jahren
nach dem Krieg musste er sehen, wie er
über die Runden kam. So war er auch
dabei, wenn in der Nacht die Wildschweine
aus den Kartoffelfeldern auf den Neefer
Höhen gescheut wurden. Für jede Nacht
erhielt er eine Mark Lohn. Auch half er
schon mal dem Nachbar, dem
„Schreiner-Pitt“, in dessen
Werkstatt aus. Ansonsten nahm er jede
Beschäftigung an, die sich gerade so
bot. Mit einer Kippe trug der den
Stallmist in die Weinberge und setzte
gefallene Mauern wieder auf, wozu er ein
gutes Geschick hatte. Er war zudem ein
eifriger Wilderer. Ein 4-Zentner-Keiler
ging ihm einmal in die Schlinge. Und als
er einen 14 Pfund schweren Hecht mit dem
Schleif-Geil fing, wurde dieser umgehend
vom Dorfpolizisten Bohne beschlagnahmt,
der allerdings ein Festmahl
veranstaltete, auf dem auch Obrigkeiten
der französischen Verwaltung aus Zell
teilnahmen.
Sehr wohlwollend nahm „Mies“
nun das Angebot der Gemeinde wahr, in
Neef Feldschütz zu werden. Und aus
Saulus wurde nun ein Paulus. Er nahm
seine Aufgabe sehr ernst. Und dass er als
Ausweis seiner Würde ein amtliches
Abzeichen vorzeigen konnte, machte ihn
sehr stolz. Mehr oder weniger hatte er ja
auch polizeilichen Aufgaben zu erfüllen.
Einmal hat er in einem gesperrten
Weinberg den Bürgermeister Peter Josef
Kaufmann ertappt. „He, he, heee (in
einer angespannten Situation begann er
immer so) - kann ich einmal ihre
Dokumente sehen?“ – sprach er
in seinem bestmöglichen Amtsdeutsch den
Bürgermeister an. Kaufmann hatte sich
natürlich selbst keine schriftliche
Genehmigung ausgestellt. Nur nach
längerer Diskussion ließ er bei seinem
Dienstherrn Gnade vor Recht ergehen.
Kaufmann musste grinsen und entfernte
sich seinem Weinberg.
Speziell dann, wenn er aufgeregt war,
klang sein „he he hee“ sehr
hochstimmig – schon fast so wie die
Stimme eines Heldentenores. Und das
hörte sich sehr lustig an, zumal sich
die Stimme auch schon mal überschlug.
Das wussten wir Pänz. Deshalb machten
wir bei ihm auch gerne Streiche. Dabei
war oft seine Gesangseinlage
interessanter als der Streich selbst.
Zu den Aufgaben vom „Mies“
gehörte es auch, in der Weinlesezeit die
Glocke frühmorgens zu läuten. Erst dann
durfte die Lese beginnen. Er gab in
dieser Form auch am Abend bekannt, dass
die Lese zu beenden war. Schlug das
Wetter um und gab es Regen, dann wurde
auch wieder über die Glocke bekannt
gegeben, dass die Arbeiten im Weinberg zu
beenden waren. Ansonsten hätte ja die
Qualität der Ernte unter der Nässe
gelitten.
Auch die Schwarzschlächter hatte er
im Visier. Da in der Regel in der Nacht
„schwarz geschlachtet“ wurde,
schlich er auch in der Dunkelheit im Ort
umher und schaute nach, wo verdächtiger
Rauch aus dem Schornstein drang.
Die Familie vom
„Schreiner-Pitt“, die dem
„Mies“ ja in seiner ärmsten
Zeit so sehr unterstützte, hatte schwarz
geschlachtete. Nun hatte man Angst, dass
der Nachbar etwas gemerkt haben könnte.
„Mies“ hätte sie dann umgehend
angezeigt. Der hätte kein Pardon
gekannt! Um jeder Verdächtigung aus dem
Wege zu gehen lud man gleich am Tag nach
der Hausschlachtung „Mies“ ein,
mit zum Metzger nach Bullay zu fahren, um
bei ihm dringend benötigte Fleischwaren
zu kaufen. Diese Einladung nahm er gerne
an, da auch er sich dort etwas eindecken
wollte. Und er bedankte sich beim
„Schreiner-Pitt“, als dieser
ihm eine große Blutwurst spendierte.
„Mies“ hatte also nichts von
der Hausschlachtung gemerkt. Die
„Schreiners“ waren beruhigt.
Als Jugendliche von ihm beim
Kirschenklauen erwischt wurden,
flüchteten diese auf den Baum hinauf.
„Mies“ setzte sich unter den
Baum und wartete stundenlang, bis die
Diebe endlich herunter kamen. Er hatte
sie erkannt, und es folgte eine Anzeige
beim Ortspolizisten.
Die speziellen und originellen
Vorgänge um den „Mies“ sind
hier längst nicht alle aufgeführt.
Jeder, der in der damaligen Zeit lebte,
kennt dieses Original und könnte noch
mit anderen „Stückelchen“ die
Chronik bereichern. Sie alle
aufzuführen, würde ein ganzes Buch
ausfüllen.
Im fortgeschrittenen Alter wurde der
„Mies“ kränklich. Er konnte
seine Tätigkeit nicht mehr ausüben.
Auch zu größeren körperlichen Arbeiten
war er nicht mehr fähig. So war er denn
wieder ein „armer Schlucker“.
Für seine Altersversorgung hatte er
naturgemäß nur spärlich vorgesorgt. In
dieser erbärmlichen Situation erreichte
es der Nachbar Martin Nachtsheim, dass
seine äußerst bescheidene Rente doch
noch etwas aufgestockt wurde. Zu einem
bescheidenen Leben reichte es allerdings
immer noch nicht. So betätigte er sich,
hauptsächlich in der Winterzeit, mit
„Weiden machen“, saß dann am
Ofen in seiner dürftigen Behausung und
spaltete die Weidenruten, mit denen im
Frühjahr die Reben gebunden wurden. Im
Sommer dengelte er für die Nachbarschaft
die Sensen. Ab und zu war er auch als
Totengräber tätig. Und wenn in Neef
jemand geschlachtet hatte, erhielt
„Mies“ aus Mitleid nicht selten
ein Marmitche Wurstsuppe und auch
Schmalzgrieben.
Im Jahr 1966 starb der
„Mies“ im Alter von 86 Jahren.
Es fiel auf, dass bei seiner Beerdigung
kaum ein Jugendlicher teilnahm. Weshalb
wohl?
Überlieferungen von Erna Kreuter,
Alfred Kaufmann, Alfons Kreuter und
eigene Erinnerungen des Chronisten
|
 |
| In diesem
einfachen Häuschen wohnte
"Mies" |
| |
 |
| Der Besitz einer
amtlichen Plakette ehrte ihn |
|
| |
|
 Finanz-Verwalter
/ -Berater Finanz-Verwalter
/ -BeraterDie Grafen von Sponheim, die
Herren von Neef, hatten sich nie wegen
finanzieller Geschicklichkeit
hervorgetan. So halfen mehrmals die Juden
Isaak und Namegud aus Kirchberg aus, um
finanzielle Engpässe zu überwinden. Als
Sicherheit mussten diesen Bürgen
herangebracht und auch wertvolle Rechte
und Besitztümer verpfändet werden, die
oft nicht eingelöst wurden. Es gab immer
wieder Turbulenzen und Streitigkeiten in
finanziellen Angelegenheiten.
Kaiser Ludwig sprach Graf Gerhard, dem
„Neven“ (dem Neefer) anno 1320
im Felde von Hagenau das Hohe Gericht zu.
Seither hatten die Herren von Neef das
Recht, „ … beym schopff zu neme
un uff halz und bauch zu richten.“
Der Galgen wurde auf einer Anhöhe im
oberen Neefer Bachtal errichtet. Dieser
Distrikt nennt sich noch heute
„Galgenkopf“.
Das Hohe Gericht war ein Reichslehen.
Gerhard stand somit im Dienste des
Kaisers. Und dieser traute offenbar dem
Neefer Grafen eine ordentliche Verwaltung
der zu erwartenden hohen
Gerichtseinnahmen gemäß der
Halsgerichtsordnung nicht zu. Deshalb
wurden dem „Neven“ vorsorglich
vom Kaiser vier Juden verlehnt, welche
die Finanzen in der Neefer Burg besser zu
regeln hatten, was offenbar auch so
geschah, denn tatsächlich traten nunmehr
finanzielle Engpässe im Neefer
Grafenhaus nicht mehr auf.
|
 |
Herr der Richter
tugentreich
Laßt alle kosten rechnen gleich.
Bezahlung der Gerichtskosten.
Holzschnitt aus der
„Bambergischen
Halsgerichtsordnung“ Bamberg
1507 |
| |
|
| |
|
 Hausierer Hausiererging von
Haus zu Haus und bot seine Waren an.
Diese waren oft Textilien und
Haushaltswaren einfacher Art. Er schlug
auch schon mal bei der Fährbude einen
Stand auf und verkaufte dort seine
Artikel. Dies nahm die Bevölkerung dann
zum Anlass eines geselligen
Zusammenseins, zumal der Hausierer stets
auch noch Neuigkeiten aus den
Nachbargemeinden zu berichten wusste.
Zigeuner hausierten zumeist mit
Schmuck, Uhren und Teppichen. Rein
äußerlich machten diese angebotenen
Waren zumeist einen sehr guten Eindruck.
Jedoch war die Qualität oft sehr
minderwertig, was sich allerdings später
erst herausstellte, wenn der Hausierer
über alle Berge verschwunden war.
|
 |
| Bild aus dem
Archiv von Kurt Bergen |
| |
|
| |
|
 Hausschlachter Hausschlachter
Hausschlachtung war früher
hauptsächlich ein winterlicher
Höhepunkt, weil sich die kältere
Jahreszeit dazu am besten eignete.
Zumeist wurde das selbstgezogene Schwein
geschlachtet - seltener einmal ein Stück
Rindvieh. Im Dorf gab es stets mehrere
Hausschlachter. Diese schlachteten das
Tier zu Hause beim Tierhalter - daher der
Name Hausschlachter.
Als erster Hausschlachter tritt Karl
Kaspar Kreuter (1851 - 1898) in den
Annalen von Neef auf. Er war zudem Winzer
und Schnapsbrenner. Außerdem unterhielt
er den Gemeindestier.
Bevor das Tier geschlachtet wurde,
musste der Fleischbeschauer bestellt
werden. Er untersuchte es auf die
Gesundheit. War es gesund, konnte der
Schlachttermin vereinbart werden.
Nicht so formell ging die
Hausschlachterei in den ersten Jahren
nach dem Zweiten Weltkrieg zu, als sehr
oft „schwarz geschlachtet“
wurde. Und dies hatte seinen Grund (S.
hierzu in dieser Chronik unter - Inhalt -
56. Neefer Stückelcher - Nr. 83 - Die
„Schwarzschlachterei nach dem
Krieg„). Der Hausschlachter hatte
dann das Tier nicht nach seiner
Gesundheit untersucht, wozu ihm das
Wissen fehlte und er zudem auch die
notwendigen Geräte nicht hatte. So wurde
folglich nicht festgestellt, ob Trichinen
das Fleisch verdorben hatten, was große
gesundheitliche Schäden zur Folge haben
konnte. Dieses Risiko ging man ein.
Andererseits konnte man zur
„Schwarzschlachterei“ nie und
nimmer den dörflichen Metzgermeister in
Anspruch nehmen. Wäre eine solche
illegale Schlachterei bei ihm aufgedeckt
worden, hätte es ihm auf Anhieb seine
Existenz gekostet.
|
 |
Der
Hausschlachter Karl Kaspar
Kreuter
Foto aus den Archiv von Kurt
Bergen, Neef |
| |
| |
| Bild links: Nach
der Schlachtung gab es das
"Schlachtfest". Es
wurde nach Herzenslust probiert
und abgeschmeckt. Die ganze
Familie war dabei. Holzschnitt
des Tübinger Kalenders von 1518 |
|
| |
|
 Hebamme HebammeDas Wort
Heb-amme steht für althochdeutsch
heb(e)/ hevan - „heben“; amme
für „Ahnin“ - bezeichnet die
Großmutter des Neugeborenen, die das
Neugeborene ins Leben hebt. Aus dieser
Wortbedeutung wird erkennbar, dass die
Hebamme stets ältere, gestandene und
erfahrene Frauen waren. Schon im Alten
Testament werden sie erwähnt: Die
Frauen, die anderen Frauen bei der Geburt
eines Kindes helfen. Der Beruf der
Hebamme ist also uralt.
Während des Mittelalters traten im
großen Maße Totgeburten auf, die für
die Wöchnerin oft den Befall des
Kindbettfiebers zur Folge hatten. Trat
diese Infektionskrankheit auf, bestand
nur noch eine geringe Überlebenschance.
Insbesondere kirchliche Behörden
bemühten sich darum, dass die
zuständige Hebamme ein gewisses Quantum
an Fachwissen hatte. Dies zum einen aus
medizinischen Gründen, zum anderen aber
verstärkt aus der Tatsache heraus, dass
bei der hohen Zahl von den
lebensgefährlichen Totgeburten Hebammen
häufig die Nottaufe vornahmen. Und so
wird es begreiflich, dass die Kirche Wert
darauf legte, die Ausübung des Taufaktes
nur durch gewissenhafte, religiös
fundierte und mit den Zeremonien
vertraute Personen vornehmen zu lassen.
Als die Franzosen im Rheinland
herrschten (1794 – 1813), wurde die
Geburtshilfe im ländlichen Raum
verbessert. Für jedes Dorf musste eine
Hebamme berufen sein. Die praktische
Arbeit regelte das Hebammenlehrbuch, das
die Hebamme ebenso besitzen musste, wie
die „ … erforderlichen, in
gutem Zustand zu erhaltenen Instrumente
und Geräte sowie das erforderlichen
Desinfektionsmittel.“ Allgemein
übten Hebammen ihren Beruf unter
Aufsicht des Kreisarztes aus. Er erhielt
in jeden Fall Mitteilung, wenn
Kindbettfieber, Missgeburt oder Tod bei
einer Geburt auftraten. Zudem musste die
Wöchnerin nach der Geburt von der
Hebamme gewaschen und versorgt werden.
Sie hatte auch weiterhin von der Kirche
aus die Befugnis zur Spendung der
Nottaufe.
Der Hebammenberuf war ein angesehener
Frauenberuf, aber mit weniger
ansehnlicher Entlohnung. Immerhin gab es
für ihn ein gesetzlich garantiertes
Mindesteinkommen. Dies reichte jedoch
nicht aus, um eine Familie zu ernähren.
Mit Barbara Treis, geb. Binzen, (1875
– 1946) endete, bedingt durch den
Trend zur Krankenhausentbindung, der
Hebammenberuf in Neef. Zuvor waren die
Hausgeburten üblich.
Der Ehemann von Barbara war der
Schneider Mathias Treis (1868 –
1948). Mit seinem Einkommen und dem
seiner Ehefrau führte die sechsköpfige
Familie ein bescheidenes Leben in einem
einfachen Fachwerk-Haus im Neefer
Unterdorf. Dieses wurde durch einen
Bombenangriff im März 1945 zerstört.
Barbara lag recht lange schwer verletz im
Trümmerhaufen bis sie endlich gerettet
wurde. Sie war fortan körperlich und
psychisch so lädiert, dass sie an den
Folgen dieses schrecklichen Geschehens
schon im folgenden Jahr verstarb.
|
 |
| Barbara Treis |
| |
 |
Hebamme - ein
uralter Frauenberuf
aus: Eucharius Rößlin, Der
Swangern frawen und hebamme
rosegarte. Hagenau: Gran, um 1515 |
| |
|
| |
|
 Hofmann HofmannEin
namentlich bekannter Hofmann in Neef war
1624 Carl Gitzen. Er war verheiratet mit
Anna geb. Ollig.
Der Hofmann wurde auch Villicus
genannt, was ausdrückt, dass er als
Verwalter eines Gutes ein Leibeigener
seines Herren war.
Bei der Verlesung des Weisthums des
Propsteihofes St. Florin zu Neef aus dem
Jahr 1585 tritt ein Hofmann in seiner
Funktion auf. S. auch hierzu weiteres
unter der Berufsbezeichnung
„Vogt“.
|
|
| |
|
 Holzschuhmacher Holzschuhmacher
schnitzten aus Fichten, Birken, Erlen,
Pappel oder Nussbaumholz Schuhe aus einem
Stück oder Holzsohlen, die sie mit einem
Oberteil aus Leder versahen (Pantoffel).
Holzschuhe waren die Fußbekleidung
des einfachen Volkes. Kostbar verziert
wurden sie mitunter auch von Edelleuten
getragen.
Die schwierige Arbeit war das
Herausarbeiten der Rohform mit der
Breitaxt aus dem Holzklotz. Waren beide
Schuhrohlinge gehauen, die Fußformen
angerissen, konnten die Außenflächen
mit dem Schabeisen geglättet werden. Im
Anschluss daran wurden die Schuhe in die
Werkbank eingekeilt, der Innenraum mit
Spiral- und Löffelbohrer sowie mit Hohl-
und Ringmeißel ausgehöhlt und die
Unebenheiten mit dem Abrüstmesser
beseitigt. „Bessere“ Holzschuhe
bekamen noch einen schwarzen Anstrich,
und zu ihrer Verzierung schnitt man
Ähren- oder Blumenmuster auf den
Vorderteil, den „Himmel“.
Holzschuhmacher müssen in Neef eine
bedeutende Rolle gespielt haben. So gab
es ein großes Waldgebiet unterhalb des
Hochkessels, das sich „Schuh
Holtz“ nannte, wie es die Landkarte
von Tranchot und . Müffling aus den
Jahren 1803-1820 zeigt. Auf einer anderen
Karte aus jener Zeit wird das Gebiet auch
„Schuhholtzwald“ genannt.
|
|
| |
|
 Kesselflicker,
fahrendes Volk Kesselflicker,
fahrendes Volk |
|
| |
|
 Der Köhler mit seinen
Kumpanen in den Waldungen des Neefer
Hochkessels Der Köhler mit seinen
Kumpanen in den Waldungen des Neefer
HochkesselsAls der Mensch die
Möglichkeit erfand, aus Erzen Eisen zu
schmelzen, war dies ein bedeutender
Meilenstein in der Evolutionsgeschichte
des homo sapiens. Die sogenannte
Eisenzeit begann etwa 800 vor Christi
Geburt.
Und um Eisen zu gewinnen oder es
gefügig zu machen, benötigte man zu dem
Schmelzvorgang die Holzkohle. Sie
erbrachte den erforderlichen Hitzegrad.
Die Holzkohle stellt der Köhler her.
Er lebte bei Wind und Wetter irgendwo im
tiefsten Wald, fernab der
Dorfgemeinschaft und seiner Familie. Hier
hatte sich ein Gruppe von Männern, die
ihm zu Hilfe standen, Hütten gebaut. Auf
einem Lager von Moos und Stroh wurde
geschlafen. Vor den Hütten brannte stets
ein Feuer, auf dem gekocht wurde und an
dem man sich erwärmte. Eine
Körperpflege gab es kaum. Und weil der
Köhler nichts anderer tat als schwarze
Kohle zu brennen, sah er entsprechend aus
und wurde “der schwarze Mann”
genannt. Als solcher ist er eine Gestalt
in Sagen und Märchen. Bei ihm fanden
Bandenmitglieder am Tage und in der Nacht
Unterschlupf, und es wurden Überfälle
ausbaldowert. Dabei trank man billigen
Fusel-Schnaps. Es wurde auf die
Herrschaften geschimpft, gewürfelt und
laut geflucht. Man war ja unter sich und
konnte sich gehen lassen. Keiner hörte
zu.
Die Grundherren wiesen die
Kohlschläge zu und verpachteten sie für
einen festen Preis. Der Köhler war nun
weitgehend unumschränkter Vorsteher
einer Köhlerrotte. Er gab die
Anweisungen und erledigte die
Lohnzahlungen.
Für die Anschaffung des Holzes war
der Holzfäller zuständig. Zur
Verkohlung wurden alle vorkommenden
Baumarten verwandt. Die Qualität der aus
ihnen gewonnenen Holzkohle war jedoch
verschieden. Die beste Kohle lieferte die
Buche und die Hainbuche – gefolgt
von Eiche und Birke.
Der Holzknecht, die rechte Hand des
Köhlers, schichtete den Holzstapel, den
man Meiler nannte, auf. Sein Standort lag
in der Nähe des zu verkohlenden Holzes.
Der Transport der leichten Köhle war
nämlich einfacher als der des schweren
Holzes. So wechselte man öfters die
Stelle des Meilers.
Es begann nun die Verkohlung. Bei
einer üblichen Größe von ca. 40
Raummeter Holz dauerte die
Verkohlungsprozess etwa sechs bis acht
Tage – bei zwischen 300 bis 350 Grad
Hitze. Der Köhler hatte darauf zu
achten, dass durch Regelung des Windzuges
der Meiler weder erlosch noch in helle
Flammen aufging. Die Witterung spielte
beim Verkohlen eine große Rolle. Am
günstigsten war eine gleich bleibendes,
windstilles Wetter. Starker Wind und
Sturm waren die größten Feinde der
Köhlerei und konnten zu Waldbränden
führen.
Eine besonders große Rolle spielte
das Vorhandensein von Wasser, mit dem der
Meiler “kalt gemacht” wurde.
Nach dem Löschen der fertigen Holzkohle
wurde diese in Körbe geschippt und in
einer Scheune untergestellt. Sie stand
nun dem Eisenbrenner oder dem Waldschmied
zu Verfügung. Diese hatten sich
zweckmäßigerweise nicht selten in der
Nachbarschaft des Köhlers
niedergelassen.
Kohle, die man nicht vor Ort
verbrauchte, wurde von Fuhrleuten mit
Ochsenkarren abtransportiert. Bei
Schmieden und Eisenwerken, oder auch bei
Händlern fand sie reißenden Absatz.
Zu der Köhlerrotte gesellte sich auch
oft der Aschenbrenner. Er verbrannte das
zur Kohleherstellung nicht verwendbare
Geäst und auch angefaulte Baumstämme.
Die Bauern kauften ihm gerne die Asche
zur Düngung ihrer Weinberge und Äcker
ab. Auch war diese Pottasche ein
wichtiger Grundstoff zur Glasherstellung
und somit von Glashütten sehr begehrt.
So hatte sich also eine handfeste
Männergruppe um den Köhler herum
versammelt: Holzhauer, Holzknechte,
Eisenbrenner, Waldschmiede, Aschenbrenner
und Fuhrleute.
In den landesherrlichen Waldungen, wie
auch im kurfürstlichen Neefer Revier auf
dem Hochkessel, war Kohle brennen nur mit
Genehmigung der Herren von Neef
zulässig. An diese war auch die
festgesetzte Pacht zu zahlen. Weiter
musste ihnen die Menge des zu
verkohlenden Holzes gemeldet werden.
Unbefugtes Brennen wurde mit hohen
Geldstrafen, ja sogar mit körperlicher
Züchtigung, bestraft. Streng achtete man
darauf, dass der Köhler sein Produkt
nicht außerhalb der Herrschaft
verkaufte. Diese Einschränkung galt
jedoch nicht für die Herrschaften
selbst.
Die frühere Köhlerei,
einschließlich einer Eisenverarbeitung,
lassen sich auf dem Hochkessel deutlich
nachweisen. So nennt sich auch ein
großer Distrikt auf diesem höchsten
Berg des Umfeldes Kügelswald bez.
Köhlerwald. Hier findet man auffallend
häufig an verschieden zentralen Plätzen
Reste von Holzkohlneteilen und auch
tiefschwarze Erde. Aufgefundene
verschlackte Steine lassen erkennen, dass
hier auch einmal Eisen geschmolzen und
geschmiedet wurde. Schmelzvorgänge von
Eisen verursachen bei mehr als 1000 Grad
Hitze solche Verschlackungen. Weitere
Beweise hierzu liefern aufgelesene Funde
eines grob gegossenen Messers und eines
kollidierenden Eisenbarrens. Deutlich ist
auch heute noch zu erkennen, dass man zur
Beschaffung von Wasser eine Quelle
unterhalb der Bergkuppe in einem
angelegten Teich auffing. Als weiterer
Beweis der früheren Aktivitäten fällt
ein ausgeprägtes alte Wegenetz auf. Es
ist noch an vielen Stellen zumindest in
Teilstrecken deutlich erkennbar. Ohne die
Wege und „Karrete“ (schmale und
oft steile Waldwege, wodurch nur ein
Ochsenfuhrwerk passte) hätten
schließlich die „Waldmenschen“
nicht versorgt werden können und wäre
auch der Abtransport der Holzkohle, der
Pottasche und des geschmiedeten Eisens in
Tal nicht möglich gewesen.
Ob die Erzgrube in Neef das zu
schmelzende Gestein den Eisenschmieden
auf dem Hochkessel geliefert hat, bleibt
nur zu vermuten. Das Alter des Stollens
ist noch nicht erforscht. Fachleute
vermuten, dass es ihn schon lange gibt,
zeitweise unbenutzt war und im 18. Jh.
versuchsweise wieder aktiviert wurde.
Im Laufe der Zeit waren große
Waldflächen im Terrain des Hochkessels
kahl geschlagen. So ordnete im Jahre 1582
der Trierer Kurfürst an, dass der Wald
neu bepflanzt werden muss, was auch
umgehend so erfolgte. Seit her nennt sich
diese Flur Junger Wald.
Wegen schlechter Regierung war im 18.
Jh. das Deutsche Reich nicht mehr unter
Kontrolle. Es blühte das Bandentum. So
erging denn auch an die Gemeinde Neef am
14. Dez. 1784 der kurfürstliche Befehl,
unbedingt verdächtiges umherschweifendes
Gesindel anzuhalten, weil „gerade
diese heimatlosen Vagabunden all zu oft
den harten Kern einer Räuberbande
stellen“. Diese deutliche Anweisung
von oberster Stelle aus hatte sicherlich
auch, vielleicht sogar in erster Linie,
dem Köhler mit seinen Kumpanen in den
Waldungen des Hochkessels gegolten –
was jedoch vermutlich mit Fassung zur
Kenntnis genommen wurde.
Literaturnachweis:
Forstgeschichte, Ein Grundriss für
Studium und Praxis, Karl Hassel
Blätter zur Heimatgeschichte von
Trippstadt, Sonderheft Köhlerei, Karl
Munzinger
Die Köhlerei – ein Handwerk mit
ehrwürdigem Alter, Eifeljahrbuch 1983,
A. Zebedies, Paul Marx
Die „Verkohlung der
Eifelwälder“ im 17. Jh., Landkreis
Mayen-Koblenz, Jahrbuch 1996, H.D.
Stephani
Kartennachweis:
Kartenaufnahme der Rheinlande durch
Tranchot und v. Müffling 1803-1820
Bildernachweis:
Meiler, mit Genehmigung von Karl
Munzinger; aus Blätter zur
Heimatgeschichte von Trippstadt,
Sonderheft Köhlerei
Foto von Franz Josef Blümling
|
 |
| Die Aufrichtung
eines Meilers und der
Verkohlungsprozess |
| |
| |
 |
| Der imposante
Hochkessel ist mit seiner Höhe
von 421 m einer der höchsten
Berge des mittleren Moselgebietes
und war mit seinen großen
Waldungen ein Hauptbestandteil
des kurfürstlichen Waldes in
Neef |
|
| |
|
 Küfer / Fassbauer Küfer / FassbauerFür
das Bier waren die hölzernen gebundenen
Gefäße als Aufbewahrungsgefäß im
frühen Mittelalter bereits dominierend.
Mit der Zeit fanden Holzfässer immer
mehr Verwendung, insbesonders dann, wenn
Wein transportiert wurde. Die Technik der
Holzfässerherstellung verbesserte sich
mit der Zeit, und man begegnet in der
karolingischen Epoche dem in Eisen
gebundenen Fass.
Der Beruf des Fassbauers ist ein
seltenes Handwerk geworden, welches sich
jedoch in den letzten Jahren einer
Renaissance erfreut. Gibt es zurzeit
lediglich eine Handvoll reiner Holzküfer
in Rheinland-Pfalz, so werden es
sicherlich schon bald mehr sein. Diese
Prognose kann man so wagen. Einmal trägt
der groß in Mode gekommene Barrique-Wein
dazu bei, der nur in Holzfässern
gelagert seine besondere Qualität und
Note erhält, zum Anderen hat man aber
auch die Erfahrung gewonnen, dass sich
der Wein im Holzfass viel besser
entwickelt als z. B. in einem
Kunststofffass. Im Holzfass sorgt der
Sauerstoff, der durch die Poren des
Naturstoffes dringen kann, für eine gute
Reifung. „Da kommt eine ganz andere
Qualität heraus“ – stellt der
Fachmann fest.
In seiner langen Tradition wird der
Fassbauer je nach Landschaft auch
Fassküfer, Büttner, Schäffler und
Kübler genannt. An der Mosel ist er der
Küfer - entstanden aus dem Lat. Cuparius
(cupa ist das Holzfass).
Ausgangsmaterial für die Herstellung
von Fässern sind dicke Stämme, die mit
dem speziellen Spiegelschnitt
zurechtgesägt werden. Dabei ist wichtig,
dass die Jahresringe als annähernd
parallele Streifen auftauchen – der
besondere Zuschnitt sorgt für
Stabilität. Die Hölzer werden – je
nach Fassgröße – auf eine Länge
von rund einem bis 2,80 Meter und 3,5 bis
8 Zentimeter Dicke zurechtgeschnitten.
Dann müssen die Dauben lange gelagert
und getrocknet werden. Für die
Außenwand des Fasses wird das Holz unter
großem Druck mit Stahlbändern
zusammengepresst; es hält ganz ohne
Klebstoff dicht. Die einzelnen Hölzer
haben in der Mitte eine andere Dicke als
am Rand. Das sorgt für den typischen
Fassbauch.
In seine Form wird das Fass durch
Flammen und Wasser gebracht: Im Inneren
wird ein Feuer entfacht, die Außenseiten
gleichzeitig feucht gehalten. Durch diese
Behandlung kann das Holz schließlich mit
viel handwerklichem Geschick gebogen
werden, ohne dass es bricht.
Anschließend fügt der Fassbauer die
Böden ein und stabilisiert das
entstandene Fass mit Stahlreifen.
Lange hatte sich an der Arbeitsweise
des Fassbauers so gut wie nichts
geändert, wie es die beiden Fotos unter
Beweis stellen.
Bis in die fünfziger Jahre des
vergangenen Jahrhunderts war es so, dass
der Küfer sowohl das Behältnis Fass
gebaut hat und für seine Pflege sowie
auch für die Weinpflege zuständig war.
Dies hat sich aber, nachdem die
Holzfässer nach und nach zuerst durch
Beton-, später durch Stahl- und
Kunststoff-, heute durch
Edelstahlbehälter ersetzt wurden,
grundlegend geändert. So sind aus einem
zwei Gewerke geworden, nämlich dem
Böttcher und dem Weinküfer.
Nach der heutigen
Ausbildungsverordnung ist der Weinküfer
der Lebensmittelhandwerker, der alle
Fertigkeiten besitzt aus ihm anvertrauten
Trauben oder auch anderen Früchten Wein
herzustellen. Er lernt also nicht mehr
Fässer, Bütten oder Stützen und
Bottiche herzustellen.
Die Berufe Böttcher und Brauer
standen bis zur Industrialisierung eng
zusammen und waren sogar in einer Zunft
organisiert. Strenge Vorschriften gab es
zu beachten. Es galt, die Qualität der
Fässer und der späteren Füllung zu
gewährleisten. So war es z. B. durch
eine Rats-Anordnung von 1410 in Neustadt
den Küfern verboten, auf dem Markt
Dauben einzukaufen, bevor dieselben einen
halben Tag feilgehalten waren, damit sie
nicht ihre besondere Sachkunde zum
Nachteil des übrigen Publikums ausnutzen
konnten. An Orten, wo der Verkauf der
Weine einschließlich Fass üblich war,
mussten sie vielfach bei Anfertigung der
Fässer ganz genaue Anweisungen über
Größe, Ausführung usw. einhalten,
andernfalls wurden ihnen die Fässer
verbrannt; aus gleichen Ursachen war
alsdann vorgeschrieben, dass jedes Fass
den Namen des Meisters, der es
hergestellt hatte, tragen musste. Die
badische Landesordnung von Markgraf
Christoph, 1495 besagt: „Ferner soll
Niemand einigen Wein mit anderleiigem
untermischen, sondern jegliche Gattung
unvermenget lassen wie er gewachsen. Und
damit diese Ordnung desto beständiger
sei, sollen alle Küfermeister und
Küferknechte den Amtsleuten an
Eidesstatt geloben, sorglich darüber zu
wachen, dass kein Wein welcher zum
Verkaufen oder zum Verzapfen bestimmt
ist, mit fremdartigen und schädlichen
Dingen vermischt und aufgezogen
werde.“ Auch gegen die falsche
Benennung des Weines im Fass ging das
Gesetz streng vor. Dagegen hatte sich ein
Eberlin Snider aus Bulach im Elsass 1353
verstoßen. Er wurde mit Verbannung
bestraft unter Androhung der Strafe des
Ertränkens bei unerlaubter Rückkehr.
St. Apronianus war der Schutzpatron
der Fassküfer. Als Heide trat dieser im
frühen Christentum in eine christliche
Gemeinschaft ein und wurde getauft.
Als bekennender Christ wurde er
verfolgt und enthauptet. Man gedenkt ihm
am 2. Februar.
Literaturquellen:
Die letzten Küfer haben gut zu tun,
Andrea Löbbecke, Beitrag in der
Rhein-Ztg.vom 10.9.08
Vollständiges Heiligen-Lexikon, Band 1.
Augsburg 1858, S. 292
Geschichte des Weinbaus, Friedrich von
Bassermann-Jordan
Besonders über den neueren Stand gab
Herr Hans-Peter Möll, Stv.
Bundesvorsitzender des Fass- und
Weinküferhandwerks, wertvolle
Informationen
|
 |
Küferwerkstatt
1698
Aus Weigel: Hauptstände 1698 |
| |
 |
Küferwerkstatt
1948
Aus dem Fotoarchiv von K. Bergen,
Neef |
| |
| |
| |
| |
|
| |
|
 Lohschäler LohschälerZur
Herstellung von Leder brauchte man in
früherer Zeit Lohe – auch Luhe
genannt. Das war die Rinde von jungen
Eichen mit der darin enthaltenen
Gerbsäure. Bevorzugt im Frühjahr, wenn
der Baum im Saft stand, entfernte man die
Rinde vom Stamm der etwa 20 Jahre alten
Eichen mit einem Lohlöffel. Die kahlen
Stangen wurden abgeschlagen und fanden
als Brennholz Verwendung. Am Boden
entstanden wieder neue Austriebe, die
dann später wieder zur Schälung genutzt
wurden.
In einigen Gegenden wurden auch die
abgeholzten Waldstücke
„gebrannt“, um die kleinen
Äste zu beseitigen, Unkraut zu
vernichten und mineralischen Dünger zu
gewinnen. Im Mai pflanzte man dann
Kartoffel, im 2. Jahr Wintergetreide
(Roggen) und im 3. Jahr Sommergetreide
(Hafer, Gerste, Buchweisen) zwischen die
schon austreibenden Wurzelstücke. Danach
nahm der Aufwuchs der jungen Eichen
wieder Platz ein.
Die Flächen zur Lohernte stellte die
Gemeinde als sogenanntes Rottland zur
Verfügung. Dieses war in einzelne
Rottmarken aufgeteilt und wurde den
Bürgern zugelost.
Hatte man die Lohe nach Hause gekarrt,
trocknete man sie in der Scheune.
Nach der Lagerung wurde sie in Bürden zu
etwa 40 Pfund zusammengebunden.
Dann brachte man die Rindenstücke zur
Lohmühle und verkaufte sie dem
Lohmüller. Dieser häckselte und mahlte
sie, um sie danach in kleinen Blöcken an
Gerbereien weiter zu verkaufen.
Dorthin hatten Metzger und Viehhalter
Felle ihrer geschlachteten Tiere
verkauft. Diese wurden dann, nachdem man
sie zuvor enthaart hatte, zusammen mit
der Loh-Konstanz in eine mit Wasser
gefüllte Grube gelegt. Nach ein paar
Tagen entstand eine gerbsäurehaltige
Brühe. Diese baute die eiweißhaltigen
Stoffe der Haut ab. Die Häute wurden
getrocknet und konnten dann als Leder
verarbeitet werden.
Die übrig gebliebene ausgelaugte Lohe
wurde getrockneten und gepresst. Der so
entstandene Lohkuchen diente zum
Ofenanzünden und auch zur Feuerung.
Zudem fand er Verwendung in der
medizinischen Behandlung von
Hautkrankheiten verwendet.
Nachdem die amerikanischen Tannen
einen noch besseren und billigeren
Gerbstoff lieferten (seit etwa 1875) und
schließlich nach der Entwicklung
synthetischer Gerbsäuren (nach 1900),
flachte die Bedeutung der heimischen
Eichenlohe nach und nach bis hin zur
Bedeutungslosigkeit ab. Die letzte Lohe
wurde in den Moselhängen 1945/1946
geschält - so auch im Neefer Bachtal.
Noch heute wird der Hang zur Gemarkung
"Schopp" zu
"Luh-Heck" genannt.
In Köln gab es anno 1746 die
stattlich Anzahl von 57 Lohhöfen. Heute
erinnern nur noch einige
„Lohmühlen“ als Ausflugslokale
an ihre frühere Blütezeit.
Als den Gerbereien die chemischen
Hilfsmittel als Folge der
Nachkriegswirren fehlte, besann man sich
der alten Traditionen – allerdings
nur für eine kurze Zeit. Die Gerbereien
sind auf eine geringe Anzahl von
Großbetrieben mit neuesten
Verfahrenstechniken zusammengeschrumpft.
Und dorthin werden die Felle zumeist von
Schlachthäusern aus dem In- und Ausland
in Containern angeliefert. 1870 bestanden
im Trierer Lande 300 Gerbereien, 1898
waren es 113 und 1903 43 Betriebe. Heute
gibt es nur noch 3 Gerbereien in
Regierungsbezirk Trier – im
Reg.-Bez. Koblenz gibt es keine einzige
mehr.
Viele Familiennamen erinnern uns heute
an die Zeit, in der die Lohe, deren
Verarbeitung und Verwendung, eine solch
große Bedeutung hatte. Als man allgemein
die Familiennamen einführte, nannte man
sich vielfach auch nach seiner
Tätigkeit. So gibt es recht häufig die
Familiennamen wie Luhe, Luhmann, Luhberg,
Luhheck, Luerer, Lohe, Lohmann,
Lohmüller, Lohmacher, Löhrer, Gerber
und viele andere mehr.
Die Lohe war ein wichtiger
wirtschaftlicher Faktor in den
Moselgemeinden.
Besonders in armen Zeiten konnte sie
finanzielle Engpässe überwinden helfen.
Literaturquelle:
Görgen, Rolf; Ihre Bremmer Knutze
...
Schommers, Reinhold; St. Aldegund an der
Mosel Steffens, Willi; Vom Lohschälen in
der Eifel
Bildquelle:
Lohschäler: aus dem Archiv von
Reinhold Schommers, St. Aldegund
Lohlöffel: Foto von F.J. Blümling
(Autor)
|
 |
| Lohlöffel |
| |
 |
| Lohschäler bei
der Arbeit |
| |
| |
| |
| |
|
| |
|
 Maulwurfsfänger MaulwurfsfängerUnsere
Vorfahren haben Tätigkeiten ausgeübt,
von denen wir Heutige nichts mehr oder
nur wenig wissen. Mit der raschen
Veränderung der Arbeitswelt sind
zahlreiche Berufe untergegangen.
Eine amtliche Anweisung aus dem 19.
Jahrhundert wirft ein Licht auf die Nöte
unserer Vorfahren, einer Mäuseplage Herr
zu werden. Auch den Maulwurf bekämpfte
man rücksichtslos, da die von ihm durch
Wühlarbeit aufgeworfenen Erdhaufen beim
Mähen störten. Das Grünfutter wurde
verschmutzt und die Sense war schnell
abgestumpft, wenn sie in einen solchen
Haufen geschwungen wurde. Letztlich blieb
dem Mäher nichts anderes übrig, als den
Arbeitsvorgang abzubrechen, um zu Hause
das Sensenmesser neu zu dengeln (Die
Schneide wurde durch Hämmern wieder
scharf geschlagen.). Aber auch im
Gemüsegarten waren die
Hinterlassenschaften des Maulwurfs
störend.
So gab es denn den Beruf des
Maulwurfsfängers in allen Landschaften
Deutschlands. Der Maulwurfsfänger hatte
diesen Beruf in aller Regel nicht als
Haupterwerb – konnte aber für so
manch sorgenden Familienvater einen
willkommener Nebenerwerb bedeuten. Für
jedes gefangene Tier gab es eine Prämie.
Als Beweis für die Anzahl der erjagten
Tiere diente der abgetrennte Schwanz. Die
Maulwurfsfelle fielen einer Verwertung
zu. Sie wurden zu Rechtecken
zugeschnitten, auf Brettern zum Trocknen
aufgenagelt und schließlich vom Gerber
und Kürschner weiterverarbeitet.
Damenmäntel aus Maulwurfsfällen waren
chic. Muffe zum Händewärmen, Besatz an
Kleidungsstücken aus Maulwurfsfell, auch
Westen und Hüte für Männer sowie
Geldbeutel wurden daraus hergestellt.
In unserer Region, war mein
Urgroßvater, Johann Peter Blümling
(geb. 1816 in Biebern – gest. 1872
in Senheim), Maulwurfsfänger - außerdem
war er auch noch Maurer und Korbmacher.
Er war mit Maria Christina verheiratet.
Die Ehe hatte 7 Kinder.
Der Chronist – Franz Josef
Blümling
|
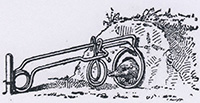 |
| Zum Fang des
Maulwurfes wurde eine Falle
benutzt |
| |
| |
|
| |
|
 Maurer MaurerSeit die
Menschen die Höhlen verließen und sich
eigene Häuser bauten, gibt es den Beruf
des Maurers.
Einer der vielen Maurer, die in allen
Zeiten in Neef ihren Beruf ausübten, war
Josef Sonntag (geb. 28.08.1890 –
gest. 16.01.1966). Zuerst war er als
Nachtheizer und Maschinenarbeiter bei der
Bahn beschäftigt. Da er nicht in die
National-Sozialistischen Partei (NSDAP)
eintrat, wurde das Arbeitsverhältnis bei
der Bahn aufgelöst. Er ging nunmehr dem
Beruf eines Maurers nach. Als solcher war
er beschäftigt bei der Fa. Calliari in
Bullay.
Nebenbei half er auch bei so manchem
Aufbau von bombardierten Häusern, die es
im Ort nach dem Kriegsende zu Hauf gab.
Er zeigte nebenbei sehr großes Geschick
bei der Aufrichtung und Renovierung von
Weinbergsmauern, wozu er immer wieder
Aufträge erhielt.
Sonntag bewirtschaftete auch bis zu
seinem hohen Alter einen kleinen
Weinbergbesitz. Die Ernte daraus diente
in erster Linie dem Eigenbedarf. Nur in
den Jahrgängen, in denen es einen
reichlichen Ertrag gab, konnte er auch
schon mal ein Fass Wein verkaufen.
Er war ein sehr biederer, fleißiger,
anständiger Mensch und treusorgender
Familienvater. Verheiratet war er mit
Catharina geb. Schilken und hatte 3
Kinder.
|
 |
| Noch im hohen
Alter ging Josef Sonntag gerne in
seinen Weinberg |
| |
| |
|
| |
|
 Metzgerei Steinebach Metzgerei SteinebachJakob
Steinebach (geb. 1906 – gest. 1993)
begann 1923 mit gerade 17 Jahren seine
Lehre im Fleischerhandwerk bei seinem
Onkel in Koblenz. Nach erfolgreicher
Abschlussprüfung war er dort mehrere
Jahre als Geselle tätig. Mit 38 Jahren
machte er vor der Handwerkskammer Koblenz
seinen Meisterbrief im Fleischerhandwerk.
1933 machte er sich mit seiner Frau
Anita (geb. 1910 gest. 1997) in
Gillenfeld (Eifel) selbständig. Doch
bereits schon ein Jahr später verließen
sie Gillenfeld und bauten sich in
Cochem-Cond eine neue Existenz auf. Als
1936 der Neefer Metzger Wilhelm Schmitz
verstarb, pachtete Jakob Steinebach ein
Jahr später den Neefer Metzgereibetrieb
des Verstorbenen.
Jakob kam nun als Soldat in den Krieg
und wurde 1946 aus der Gefangenschaft
entlassen. Zwischenzeitlich hatte sich
jedoch der Sohn von Wilhelm Schmitz,
Peter Wilhelm, in den elterlichen Räumen
als Metzger niedergelassen. So erwarb
Jakob Steinebach umgehend im Neefer
Unterdorf ein Haus und betrieb dort in
eigenen Räumen eine Metzgerei. Im
gleichen Jahr begann auch Sohn Karl Heinz
(geb. 1930) im elterlichen Betrieb seine
Metzger-Lehre.
Nach seiner Lehrzeit ging Karl Heinz
nach Frankfurt, wo er in mehreren
renommierten Betrieben der
Fleischerbranche tätig war.
Hervorzuheben sind dabei das hoch
angesehene Hotel „Frankfurter
Hof“, wo er sich als Küchenmetzger
bewährte und das Feinkostfachgeschäft
Hermann Kirchenbauer auf der Frankfurter
Einkaufsmeile ersten Ranges, der Zeil, wo
er für die Herstellung von
Spezialitäten zuständig war. In
Frankfurt besuchte Steinebach jr. die
Meisterschule Hyne und legte dann im
Jahre 1955 die Meisterprüfung ab. Auf
Wunsch seiner Eltern kehrte er 1958
wieder nach Neef zurück und half im
elterlichen Betrieb. 1962 machte Karl
Heinz Steinebach sich schließlich
selbständig. Er übernahm die Metzgerei
Gröff in Zell-Merl. Sechs Jahre später,
1968, übergaben ihm die Eltern das
Geschäft in Neef, das er zusätzlich als
Filiale bestehen ließ.
Die praktischen Erfahrungen, die der
junge Steinebach in Frankfurt gemacht
hat, kamen ihm in seiner Selbständigkeit
sehr zu gute. Besonders seine guten und
schmackhaften Wurstsorten waren sehr
gefragt. Wöchentlich wurden bis zu 30
Schweine und 5 Stück Großvieh
geschlachtet. Karl Heinz kaufte das Vieh
direkt bei den Bauern in der Eifel und im
Hunsrück. Fleischwaren wurden nicht nur
im eigenen Laden verkauft. Es wurden
zudem Lebensmittelgeschäfte, Hotels und
Gastwirtschaften im ganzen Umfeld
beliefert.
Karl Heinz Steinebach kann mit Stolz
auf eine erfolgreiche Berufstätigkeit
zurückblicken. Er hatte sich nach und
nach zielstrebig hochgearbeitet. Die
Handwerkskammer Koblenz ehrte ihn im Jahr
2005 mit dem „Goldenen
Meisterbrief“.
Karl Heinz Steinebach gab seine
Metzgerei in Zell-Merl aus
gesundheitlichen Gründen im Jahre 1988
auf. Gleichzeitig wurde auch der
Filialbetrieb in Neef eingestellt.
Zusammengestellt nach Angaben von
Karl-Heinz Steinebach, Zell
 |
|
 |
| Metzgermeister
Jakob Steinebach |
|
mit seiner
Ehefrau Anita |
|
 |
| "Schmitze
Willi" (links auf dem Bild)
mit einem schlachtreifen Ochsen
vor seinem Schlachthaus Foto aus
dem Archiv von Kurt Bergen, Neef |
| |
| |
 |
| Karl Heinz
Steinebach wird mit dem
„Goldenen Meisterbrief“
geehrt Foto von K.H. Steinebach |
| |
| |
| |
| |
|
| |
|
 Polsterer- und
Sattler-Meister Clemens Rohrbach Polsterer- und
Sattler-Meister Clemens RohrbachIn
der früheren Zeit gab es sie nicht, die
so genannte Weg-Werf-Gesellschaft –
noch nicht den Begriff „ex und
hopp“ (kaufen – benutzen –
wegwerfen). War in damaliger Zeit ein
wichtiger Gegendstand des Alltages kaputt
oder beschädigt, dann wurde er durch
geschickte Handwerkerhände repariert.
Neue Sachen wurden handwerklich
hergestellt. Und das dauerte seine Zeit.
Heute lohnt sich eine solche
zeitaufwendige manuelle Anfertigung nicht
mehr. Es gibt die Fabriken, die über
Fließband Gegenstände in zigfacher
Anzahl stündlich förmlich ausspucken
– sogar versandfähig verpackt. Kein
Handwerker kann dann mit einem solchen
Herstellungspreis konkurrieren. Es ist
auch billiger, einen defekten Gegenstand
einfach weg zu werfen, als ihn reparieren
zu lassen. Die Reparaturkosten wären
wesentlich höher, als der Preis für
eine Neuanschaffung.
Aber auch die Gebrauchsgegenstände
des täglichen Lebens als solche haben
sich geändert. So wird z. B. das Joch
für ein Kuh- oder für ein Ochsengespann
zumindest in unserer Region nicht mehr
benötigt. Früher zogen Kuh und Ochse
den Wagen auf das Feld oder in den
Weinberg - heute transportieren die
Traktore.
Das Handwerk des Polsterers und
Sattlers hatte nach dem Zweiten Weltkrieg
eine besonders große Wichtigkeit. Viele
erforderliche Materialien gab es während
der Kriegsjahre nicht mehr. Es konnte
also kaum noch hergestellt, erneuert oder
repariert werden. Und ansonsten waren ja
auch die Männer zumeist im Kriegseinsatz
und danach in der Gefangenschaft. Es gab
also einen großen Nachholbedarf. Das
Sattler- und Polsterhandwerk hatte
besonders in jener Zeit eine weittragende
Bedeutung und hatte besonders im
wirtschaftlichen und sozialpolitischem
Bereicht ein hohes Gewicht - so stellte
der Präsident des
Zentralinnungsverbandes des Deutschen
Sattler- und Polstererinnungsverbandes
Julius Debus anlässlich der 50jährigen
Jubiläumsfeier auf dem Landesverbandstag
in Neustadt a. d. Weinstraße im August
1960 fest.
In Neef gab es den Polsterer- und
Sattlermeister Clemens Rohrbach (1904
– 1967). Er kam aus dem Nachbarort
Senheim. 1936 heiratete er das Neefer
Mädchen Paula Budinger. Seine Lehre
vollzog er in Merzig (Saarland) bei der
Firma Bettenfeld. Die Meisterprüfung
legte er 1939 vor der Handwerkskammer
Koblenz ab und machte sich dann in Neef
selbständig. Aber schon bald wurde er an
die Front eingezogen. Als er Ende 1946
aus der polnischen Gefangenschaft nach
Hause kam, gab es für ihn viel zu tun.
In der Werkstatt in seinem Haus „im
Neugarten“ erledigte Clemens
gewissenhaft seine Arbeiten. Aus dem
ganzen Dorf und aus den Nachbargemeinden
erhielt er Aufträge. Seine Reparaturen
waren gekonnt. Ob lädierte Sessel,
kaputte Sofas, defektes Sattelzeug,
zerrissene Gurte, oder beschädigte Joche
- Clemens brachte alles wieder in
Ordnung. Sein handwerkliches Können
bestand auch in der Herstellung der
damals üblichen dreiteiligen Matratzen
aus Rosshaar, Kapok und später aus
Federkern.
Die freundliche und bescheidene Art
von Clemens Rohrbach passte zu seiner
gemütlichen Werkstatt. Es roch nach
Leder und Klebemitteln, nach Rosshaar und
Stoffen. Auf dem Kohleofen brodelte der
Wasserkessel. In der Dämmerung war die
verstellbare Deckenlampe auf Augenhöhe
heruntergezogen. Clemens klebte,
fädelte, nähte, hämmerte, nietete und
trug dabei stets seine selbstgenähte
Leinenschürze.
Überliefert von Helga Mentges,
geborene Rohrbach, Bullay
Und eigene Erinnerungen des Chronisten
|
 |
| Clemens Rohrbach |
| |
 |
| Briefkopf des
Handwerkers Clemens Rohrbach |
|
| |
|
 Scherenschleifer
ScherenschleiferDer
Scherenschleifer ist ein alter
Wanderberuf. Eine Karre, worauf der
Wetzstein montiert war, genügte, um
diese Tätigkeit auszuüben. Damit zog er
über Land und durch Städte, wo er
Scheren und Messer neu anschärfte. Dazu
brauchte er kaum Kenntnisse. In der Regel
war er ein heimatloser Geselle von ganz
einfacher Art, der sich nicht pflegte und
den Schnaps nicht ablehnte. Nicht zuletzt
beschimpft man heute noch Jemanden, der
ungeschickt ist und schlechte Arbeiten
verrichtet, mit „du
Scherenschleifer“.
Gelegentlich hatte der
Scherenschleifer, um Publikum anzuziehen,
ein dressiertes Äffchen dabei. Daher
stammt die Radfahrer-Redensart: „Er
sitzt da, wie ein Affe auf dem
Schleifstein.“
Nach Neef kamen die Scherenschleifer
regelmäßig. Sie hatten um Moselufer, in
der Nähe der Fährbude, ihren Stammplatz
- zogen aber auch durch den Ort und boten
die Schleiferei an.
|
 |
| Das Bild zeigt
einen bedauernswerten
Scherenschleiferjungen: „
Ich zog mit seinem treuen Hund
den Radkarren meines Vaters, der
unmäßig betrunken und fluchend
hinten nachschob“. (Aus
Spinnstube 1849) |
|
| |
|
 Schiffbauer SchiffbauerJohann
Christian Buschbaum wurde 1753 in Neef
geboren. Anno 1781 heiratete er Anna
Maria Endres aus Alf. Die Ehe hatte 9
Kinder.
Von Beruf war J. Chr. Buschbaum
Schreiner. Als solcher fertigte er auch
kleinere Schiffe (im Volksmund: Nachen)
an. In der Familie blieb das Holzhandwerk
Tradition. So waren die Nachfolger
Stellmacher, Wagner und Küfer - s. auch
unter 62. dieser Chronik.
Im Dorf nennt man die Buschbaum‘s
bis zum heutigen Tag noch
„Scheffbejere“
(Schiffbauer/Schiffbauere).
|
 |
| Eduard Bremm
fährt mit seiner
"Mannschaft" zum
Einsatz in seinen Weinberg im
Frauenberg. Stellenweise führte
dort hin kein Wirtschaftsweg. Es
gab nur einen schmalen Pfad zu
den Weinbergen. Der Einsatz eines
Nachen war unentbehrlich. |
|
| |
|
 Schmied SchmiedDer Schmied
gilt als einer der ersten eigentlichen
Handwerker. Er übten seinen Beruf seit
dem Zeitalter des Eisens aus.
Mit Hilfe von glühender Holzkohle,
deren Hitze durch einen Blasebalg
angefacht wird, erfolgte eine Erglühung
des Eisens, so dass dieses bearbeitet und
umgeformt werden konnte, was mit Hilfe
des Hammers, des Ambosses und einer Zange
erfolgte. Nach Bearbeitung des
Eisenstückes wurde dieses in einen
Wasserbehälter zur Abkühlung
eingetaucht.
In einem Winzer-Dorf wie Neef, zu
deren Dorfgemeinschaft auch das Kloster
Stuben gehörte, wo Grafen und Ritter im
Burghaus residierten, war der Beruf die
Schmiedes immer unverzichtbar. Geräte
für den Wein- und Ackerbau, für die
Viehzucht, für die Waldarbeiten und auch
solche für kriegerische
Auseinandersetzungen mußten immer wieder
ausgebessert und neu geschmiedet werden.
Im Kloster Stuben gab es eine offenbar
recht große Schmiede. Neben einem
großen Blasebalg, einem Amboß,
verschiedenen schweren Schlaghämmern
kamen noch weitere Gerätschaften aus der
Schmiede bei der Auflösung des Klosters
zur Versteigerung, war eine Auflistung
aus dem Jahr 1789 so überliefert.
In neuer Zeit hat die Bedeutung des
Schmiedehandwerks stark verloren, und in
Neef gibt es seit den 60er Jahren keine
Schmied mehr. Es ist billiger geworden,
einen Pickel im Baumarkt neu zu kaufen,
als einen solchen in der Schmiede
herstellen oder einen alten reparieren zu
lassen.
|
 |
| Franz Joseph
Kreuter (1886 - 1952, den
„Stoater-Franz“,
(wohnte in der „Stoat“
- wo einst die Schiffe anlegten) |
| |
 |
| Für die Grafen
und Ritter im Neefer Burghaus,
die sich bei Kämpfen und
Turnieren auszeichneten, waren
stets Schmiedearbeiten
erforderlich. |
|
| |
|
 Schröter SchröterStand
bei einem Winzer der Verkauf eines Fuder
Weines an, dann wurde das volle Fass aus
dem Keller auf ein draußen stehendes
Fuhrwerk transportiert. Es gab noch keine
Weinpumpe, mit der man ein Fass im Keller
leer- und ein solches draußen hätte
voll pumpen können.
Um nun ein Fuderfass aus dem Keller zu
schaffen, wurden sechs bis acht Männer
benötigt, die Schröter genannt wurden.
Diese schlossen sich in einer sogenannten
Schröterzunft zusammen. In jedem Dorf
waren es immer dieselben Männer, welche
die Knochenarbeit besorgten und dafür
ein kleines Entgelt bekamen. Ebenso gab
es nach vollbrachter Arbeit einige Liter
„Schröterwein“, der meistens
an Ort und Stelle getrunken wurde.
Die erste Arbeit der Schröter war,
das Fass von den Lagern in den
Kellereingang zu hieven. Da es in den
meisten Kellern sehr eng war, bedeutete
auch dieses eine mühselige Arbeit. Zuvor
waren zu den Eisenreifen des Fasses noch
Reifen aus Birkenholz aufgezogen worden,
damit das Fass für den Transport besser
geschützt war. Nun wurden die Holme der
Schratleiter eingefettet, die dann auf
die Kellertreppe gelegt und mit
Eisenstäben befestigt wurde.
Nach lautem Kommandoruf wurde nun das
Fass mit Hilfe von Drahtseilen, die um
das Fass gelegt waren und einer
primitiven Winde, sowie durch die
Kraftanstrengung der Männer über die
schmierige und glitschige Leiter die
Kellertreppe hinaufgezogen. Höchste
Vorsicht war geboten, da auch die Treppen
meist steil und schmal waren. Wäre das
Fass abgerutscht, hätten die Männer,
die dahinter standen, erdrückt werden
können. So legten die Männer ab und zu
eine Pause ein und sicherten das Fass
durch das Unterlegen eines Holzscheites
vor dem Hinabrollen ab.
Nachdem die Schröter das Fass aus dem
Keller transportiert hatten, war die
schwerste Arbeit getan. Die
anschließende Beförderung des Fasses
auf einen bereitstehenden Wagen war die
leichtere Arbeit, weil draußen mehr
Platz war und die Schratleiter nun
weniger Steigung hatte.
|
|
| |
|
 Schultheiß
SchultheißAls
Beamter hatte der Schultheiß im
Mittelalter die Mitglieder einer Gemeinde
zur Leistung ihrer Schuldigkeit
gegenüber dem Landesherrn anzuhalten
(„welcher heischt, was jemand
schuldig ist“ = daher die
Amtsbezeichnung). Er nahm die Funktion
eines Richters wahr, wobei ihm
Geschworene (Schöffen) zur Seite
standen. Dem Schultheiß oblag die hohe
Gerichtsbarkeit, d. h. er hatte auch
über Leben und Tod eines Verurteilten zu
entscheiden.
In Neef übten die Grafen von
Sponheim, von Scharfeneck und von Homburg
die Funktion eines Schultheißes aus. Sie
hatten also das Recht, beym schopff zu
nehmen uff halz und bauch zu richten. Der
Galgen stand auf dem Galgenkopf - eine
Anhöhe im oberen Neefer Bachtal.
In späterer Zeit wurde der Vorsteher
der dörflichen Gemeinde Dorfschulze /
Schulze bezeichnet. Dieser war allerdings
nur noch mit der niederen Gerichtsbarkeit
betraut, die Fragen des dörflichen
Zusammenlebens bzw. der Nutzung von Feld,
Wald und Weide behandelte. Diese Aufgabe
führten in Neef im Auftrage des
Kurfürsten die Ritter von Metzenhausen
aus.
Sowohl dem Schultheiß als auch dem
Dorfschulze stand bei ihrer Tätigkeit
ein Schreiber / Gerichtsschreiber zur
Hand, der die gerichtlichen Vorgänge
protokollierte. Die letzten
Gerichtsschreiber von Neef waren Peter
Matth. Henrichs (1754 – 1808) und
Johann Busch (geb. 1745).
|
|
| |
|
 Der Neefer
Schweinehirte Johann Adam Döll Der Neefer
Schweinehirte Johann Adam DöllDer
Beruf des Schweinehirten hat eine uralte
Tradition. Er findet sowohl im Neuen als
auch im Alten Testament Erwähnung, wobei
das Schwein als solches zumeist im
negativen Sinne erwähnt wird. Das
Schwein gehörte nämlich zu den unreinen
Tieren, dessen Genuss für die Israeliten
verboten war. Dieses Verbot hatte keine
hygienischen Gründe, sonder allein
kultische. Das Schwein oder der Eber
waren im Heidentum der
Fruchtbarkeitsgöttin Astarte geweiht und
wurde ihr geopfert. Durch den Genuss von
Schweinefleisch riskierte man, eine
Verbindung mit der heidnischen Göttin
einzugehen. Deshalb essen gesetzestreue
Juden und Mohammedaner bis heute kein
Schweinefleisch.
Bis in den Anfang des 19. Jhs. fand
die Schweinemast in Mitteleuroba
bevorzugt in den Laubwäldern statt. Dort
ernährten sich die Schweine
hauptsächlich von Eicheln und Bucheckern
– daher die Bezeichnung
“Eckerich” für im Wald
gemästete Schweine.
Das Schwein war der wichtigste
Fleischlieferant. Demzufolge hatte der
Schweinehirt einen recht großen
Stellenwert und war ein oft ausgeübter
Beruf. So finden wir in dem Familienbuch
von Neef, das auch die Bewohner des
Klosters Stuben erfasst, den Schweine-
oder auch Sau-Hirte auffallend oft
aufgeführt.
In der Regel hatte jedes Dorf und
jedes Gut, also auch ein Klostergut,
einen Schweinehirten. Für das Kloster
Stuben wird also mit Sicherheit ein
eigener Schweinehirt tätig gewesen sein.
Neben den Nonnen wohnten im und um das
Kloster herum Mägde, Knechte, Müller,
Holzhauer, Schmiede und andere hungrige
Mäuler mehr. Sie alle werden auf ein
Stück Schweinefleisch nicht verzichtet
haben. Ein Privileg stand dem Kaplan für
Neef zu. Er wohnte im Kloster Stuben. Aus
dem Zehnten, den ihm die Gemeinde zu
entrichten hatte, stand ihm auch ein
Schwein zu. Dieses durfte er auf dem
Acker des Klosters halten - hatte somit
dem Schweinehirten für die Mastung keine
Kosten zu zahlten.
Im Jahr 1871 hatte Neef 573 Einwohner
– also ein relativ großer Ort. Er
rangierte mit dieser Bevölkerungs-Zahl
an sechster Stelle unter den 24 Gemeinden
der damaligen Verbandsgemeinde Zell.
Entsprechend groß sollte wohl der Bedarf
an Schweinefleisch im Ort gewesen sein.
Ein ganz besonderer Schweinehirte für
den Ort Neef war Johann Adam Döll (gest.
1771 - verheiratet mit Agnes geborene
Pfeiffer). Vermutlich hatte er mit seinem
Beruf eine alte Familientradition
fortgesetzt. Sein ihm zugeteiltes Gebiet
lag am Westhang des Hochkessels und ist
auf einem Grezstein mit einem
“D” (für Döll) kenntlich
gemacht. Es handelte sich um ein recht
großes Terrain.
Die Arbeit des Schweinehirten bestand
darin, täglich die Herde, die 50 bis 70
Tiere stark sein konnte, in den Wald zu
treiben. Oft tippelte auch die eigene
Ziege mit. Er fing damit an, zuerst die
Tiere aus einem Ortsteil, z. b. dem
Oberdorf, einzusammeln. Diese führte er
bevorzugt an einen Platz, auf dem ein
Misthaufen mit einer Jauchegrube
vorhanden waren. Dort verweilten die
Tiere gerne. Sie suhlten sich im Dreck
und waren noch vollständig, wenn der
Schweinhirte mit dem Rest der Rotte aus
dem Unterdorf erschien. Für jedes
Schwein, das mit der Herde ging, erhielt
er vom Besitzer einen Betrag. Das war
seine Haupteinnahme.
Der soziale Stand der Schweinehirten
hing weithin von der Gemeinde ab. Reiche
Dörfer haben ihren Hirten oft gut
entlohnt. In kleinen und armen
Ortschaften dagegen musste er bescheiden
leben. Doch immer reichten die Einkünfte
zu einem schlichten Dasein. Zumeist gab
es im Ort ein Hirtenhaus. Dieses bestand
aus einer Küche mit offenem Herd und
einer Stube, sowie einem Ziegenstall.
Ging es ihm schlecht, half man ihm mit
Naturalabgaben, wie Fleisch und Brot. Am
„schmutzigen“ (d. h. fetten)
Donnerstag, das ist der Donnerstag vor
Fastnacht, ging der Hirte mit einem
großen Korb in die Häuser der Bürger,
die Schweine bei der Herde hatten. Er
erhielt ein Stück Speck, eine
geräucherte Wurst oder auch einen
Schinken. Stets stand auch eine Flasche
parat für den Schnaps, den man ihm
spendete und den er nicht auf seinem
Rundgang restlos trinken konnte, sonst
hätte er den Heimweg nicht mehr
gefunden. In der Regel war man
großzügig. Zu Weihnachten und am
Kirchweihfest erhielt der Hirte einen
Laib Brot. Zudem durfte er im Wald
Fallholz für seinen eigenen Herd raffen.
Daneben gab es Trinkgelder, wenn eine Sau
vom Eber gedeckt worden war. So nebenbei
sammelte und verkaufte der Hirte auch
heilkräftige Kräuter und Salben. Sein
Arbeitsplatz war ja die freie Natur, die
ihm kostenlos zur Verfügung stand.
Stundenlang saß er auf seinem Schemel
oder ging im Schneckentempo hinter der
Herde her. Er hatte Zeit zu beobachten
und nachzudenken. So war er auch
wetterkundig und gab Wissen und seine
Beobachtungen gerne weiter. Dabei kam
auch schon mal eine angeregte Phantasie
zum Tragen. Schweinehirten zeigten sich
mitunter als recht originelle Käuze,
denen der Schalk im Nacken saß.
Der Beruf des Hirten gestaltete sich
nicht immer friedlich. Bevor die großen
Wälder im 19. Jahrhundert gerodet
wurden, lebten dort zahlreiche Wölfe,
für die die Schweine eine willkommene
Beute waren. Deshalb hütete der
Schweinehirte seine Herde zumeist noch
mit einem Gehilfen. Nur ein wehrhafter
Mann konnte Schweinehirte werden. Scharfe
Hunde begleiteten die Hirten, und sie
waren mit einem Spieß bewaffnet, um die
Schweineherde vor den Wölfen zu
schützen. Erst seit dem Jahr 1816 waren
alle Wölfe aus dem Gebiet zwischen
Mosel, Nahe, Saar und Rhein zur Strecke
gebracht und stellten keine Gefahr mehr
dar.
Wenn die Zeit zur Heimkehr anbrach,
setzte der Hirte mit kräftigem
Peitschenknall die Herde in Bewegung. Auf
dem Weg zum Dorf blies er in sein Horn,
das man bis ins Dorf hören konnte. Dann
öffneten die Bauern die Stalltür. Die
Tiere kannten ihr Haus und den Eingang in
den Stall. Bei der Herde befand sich
immer ein Eber. Auf dem Heimweg
benachrichtigte der Hirt den Besitzer,
wenn eine Sau gedeckt worden war. Dann
wußte der Bauer, wann er mit Ferkeln
rechnen konnte. Für seine
Benachrichtigung erhielt der Hirt ein
Glas Schnaps.
Mit dem Schweinhirten verschwand ein
Beruf und ein Stand, den es schon vor
tausenden von Jahren gegeben hat.
Literaturnachweis:
de Lorenzi, Thilipp, Beiträge zur
Geschichte sämtlicher Pfarreien der
Diöcese Trier, S. 471
Hasel, Karl, Geschichte der Nutzung des
Waldes in: Forstgeschichte - Ein
Grundriß für Studium und Praxis, 5.1.1
Mastung (Schweineweide im Wald)
Albert, Girardin, Ein verschwundener
Beruf: der Schweinehirt
Münster, Otto und Münster Jens
Kallfelz-Münster, Familienbuch Neef 1700
- 1798, 005, 061, 165, 268
Piacenza, Einwohnerzahlten der
Verbandsgemeinde Zell (Statistik
Rheinland-Pfalz, Amtszeitung Zell/Mosel,
Nr. 52/Freitag, 31.12.1982
Bild-Nachweis:
Foto Hochkessel F.J.Blümling
Foto Grenzstein dto.
Stich Schweinhirte Verklingende Weisen,
Lothringer Volkslieder, Band 2, Kassel
1928, S. 118
|
 |
| Hochkessel -
Seine Waldungen boten vielen
Berufen die Existenzgrundlage |
| |
| |
 |
| Grenzstein für
Revier des Schweinehirten Döll |
| |
| |
 |
| Der Schweinehirt
bei seiner Herde |
|
| |
|
 Stellmacher /
Wagner
Stellmacher /
WagnerDer Stellmacher arbeitete
recht vielseitig. So stellte er sehr oft
für den Wagner (Wagen- /
Kutschenhersteller) das Gestell her
– daher auch die Berufsbezeichnung
Stellmacher. Der Wagner wiederum war
spezialisiert auf die Radherstellung
– daher trug dieser auch oft die
berufliche Bezeichnung Radmacher.
Das Hauptarbeitsmaterial des
Stellmachers war das Holz. In der
Moselregion spezialisierte er sich auch
sehr oft auf die Fassherstellung.
Der letzte Neefer Stellmacher-Meister
war Peter Michael Buschbaum (1913 -
1983). Er hatte das Handwerk von seinem
Vater Peter Buschbaum (1878 – 1952)
gelernt.
Der „Buschbaums Pitt“ war
auch ein leidenschaftlicher Jäger und
Angler.
|
 |
| Auf dem Bild
erkennt man links vom Fass den
Vater Peter Buschbaum. Rechts vom
Fass steht sein Sohn Peter
Michael – beide mit einem
Hammer in der Hand. |
| |
| |
 |
Der
„Buschbaums Pitt“
Bilder von Manfred Buschbaum,
Neef |
|
| |
|
 Streckenwärter Streckenwärter
Der Streckenwärter war ein wichtiger
Beamter bei der Bahn. Seine Aufgabe
bestand darin, die Kontrolle des ihm
übertragenen Streckenabschnittes auf
Veränderungen und Beschädigungen am
Gleis mit dem mitgeführten Werkzeug zu
beheben. Nicht sofort behebbare Mängel
mussten markiert und umgehend dem
zuständigen Bahnmeister gemeldet werden
In dringenden Fällen hatte der
Streckenwärter für eine Sperrung der
Strecke zu sorgen, oder sogar den Zug
anzuhalten.
Der Streckenwärter für den Cochemer
Tunell war der Neefer Burger Johann
Philipps (1902 – 1959). Er kam aus
Reinfeld im Hunsrück. Zuerst war er auf
dem Bahnhof in Cochem beschäftigt.
Später arbeitete er auf der
Güterabfertigung in Neef. Dort lernte er
das Neefer Mädchen Paula Schmitz kennen,
die er 1939 heiratete.
Nach dem Krieg wurde wieder auf der
Bahn tätig und zwar als Streckenwärter.
Als solcher wurde ihm die Aufsicht im
Cochemer Tunell zugewiesen. Da dieser
Streckenabschnitt sehr gefährlich war,
musste immer ein zweiter Mann mitgehen.
Da gab es einmal die Abgase von den
Dampflokomotiven und später solche von
den Dieselloks. Es gab im mehr als 4000m
langen Tunell nur einen
Entlüftungsschacht. Weiter konnte sich
die Dunkelheit als gefährlich auswirken.
Man führte schließlich zur Verrichtung
der Kontrollarbeiten nur eine relativ
schwache Lampe mit. So konnte es
passieren, dass man einen ankommenden Zug
zu spät erkannte und eine Nische nicht
mehr erreichte. Dann musste man sich
schleunigst auf die Erde legen und den
Zug vorbeidonnern lassen. In der
Ausübung seines Berufes ist denn auch
Johann Philipps im Jahre 1959 tödlich
verunglückt. Es wurde vermutet, dass
eine Rauchvergiftung zu einem
Schwächeanfall geführt, der zu dem
Unfall geführt hat.
Den Beruf des Streckenwärters in
seiner damaligen Form gibt es heute nicht
mehr. Die fortgeschrittene Technik hat
die Gleisanlagen stabiler gemacht, so
dass laufende Kontrollen überflüssig
wurden.
Überliefert von Sohn Heinz Philipps,
Neu-Isenburg
|
|
| |
|
 Vogt VogtWährend des
gesamten Mittelalters gehörte aller
landwirtschaftlicher Besitz dem Adel,
Kirchen und Klöstern. Die Neefer Bauern
waren Leibeigene. Die Grundherren konnten
also über Leib und Leben ihrer
Untertanen verfügen. Diese hatten das
Land als Lehen – also geliehen. Als
Pachtzins hatten die Lehensleute den
Lehensherren die Hälfte der Ernte
abzugeben, die im Hofgebäude lagerten.
Die Verwaltung der Lehensgüter oblag
dem Vogt, der seinerseits einen
untergeordneten Hofmann einsetzte.
Mindestens einmal im Jahr, zumeist vor
der anstehenden Weinernte, schickte der
Lehensherr einen Bevollmächtigten nach
Neef, um das sogenannte Hofgeding
abzuhalten. Vor dem Platz des Hofes
wurden dann in einem Weisthum den
Bürgern die vom Lehensherren
festgelegten Bestimmungen verlesen. Diese
nannte man Levatio. Den Bürgern wurden
also die Leviten gelesen.
Auszug aus dem Weisthum des
Propsteihofes St. Florin zu Neef aus dem
Jahr 1585:
- Ein jeder Lehensmann hat zum
Hofgeding zu erscheinen. Es ist unnötig,
den Lehensmann dazu aufzurufen, da jeder
weiß, wann es stattfindet. Der
Lehensmann erhält einen halben Sester (
7 ½ ) Liter Wein.
- Der Lehensherr, der Propst gar
selbst, mag kommen mit 3 ½ Pferden und
beim Lehensmann, wo ihm gelüstet,
einkehren und dort Futter für die Pferde
erhalten. Die Kost gibt sich der
Lehensherr selbst. Ist dem Lehensherrn
die Schlafstätte zu eng, hat der
Lehensmann sein Bett abzubrechen und dem
Lehensherren Platz zu schaffen.
- Für Weggehen ohne Erlaubnis und
alle sonstige Ungebühr, wie schmähen,
fluchen, lästern und alles dergleichen
soll der Verbrecher leiden.
- Ein Weinbote gibt die Erlaubnis zur
Lese.
- Bei der Vorlese soll der Lehensmann
für einen Schilling Weck und einen Käs,
der eine Spanne weit ist und Wein
bringen, so dass der Vogt mit dem Hofmann
und dem Lehensmann zusammen genießen
können.
- Ist der Weinberg zum Teil gemistet,
hat der Lehensmann den ungemisteten Teil
am Hofe abzugeben. Es darf nur alle 6
Jahre gemistet werden.
- Rinnt die Bütte, in der sich die
gelesenen Trauben befinden, macht sich
der Lehensmann strafbar.
Zum Schluss sprach der Vogt die
Strafen für die Verbrecher aus und
vollzog sie oft gleich an Ort und Stelle.
Vor dem Hofgebäude stand der Pranger,
den man auch Schandpfahl nannte. An
diesen wurde der Verbrecher angekettet
und der öffentlichen Beschimpfung
preisgegeben. Hatte der Bestrafte jedoch
z. B. die Obrigkeit beleidigt, konnte es
passieren, dass Bürger den Delinquenten
mit Wein oder sonstigen Wohltaten
verwöhnten.
Der Vogt war also ein Beamter einer
geistlichen Herrschaft. Er konnte im
Rahmen eines Niederen Gerichtes Urteile
aussprechen und strafen lassen. Junker
Dietrich von Kellenbach erscheint 1529
als erster Klostervogt in Neef, als ein
Teil der Güter der Abtei St.
Willibrordus, Echternach, durch
Verpfändung an das Stift St. Florin in
Koblenz kam. S. hierzu auch unter 22. d.
- „Der Echternacher Hof in
Neef“ und unter 31. a. und 31. b. in
der Chronik.
|
|
| |
|
 |
|
| |
|
 |
|
| |
|
| |
|
| Literaturnachweise: |
| |
|
| Bildnachweise: |
| |
|
|
|